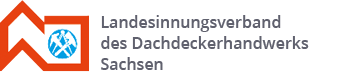Informationen für Bauherren und Architekten zum Thema
Dachbegrünung

In vielen Städten und Gemeinden werden mittlerweile Maßnahmen zur Dachbegrünung gefördert, aber auch Fördermittel können genutzt werden. Hier lohnt es auch, Kontakt mit den Kommunen aufzunehmen. Grüne Dächer leisten einen wichtigen Beitrag für die Umwelt. In Deutschland werden jährlich etwa zehn Millionen Quadratmeter Dachfläche neu begrünt, davon etwa 80 Prozent extensiv und 20 Prozent intensiv.
Von insgesamt rund 1,2 Milliarden Quadratmetern Flachdachflächen sind damit aber erst rund 130 Millionen Quadratmeter deutschlandweit begrünt. Somit gibt es auf knapp 90 Prozent der Dächer noch Kapazitäten. Für die Dachabdichtung gelten die Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen, die Abdichtungsnormen sowie die Hersteller-Verarbeitungsvorschriften. Zu berücksichtigen sind unter Umständen Europäische Produktzulassungen sowie bauaufsichtliche Anforderungen. Übrigens: Auch Solaranlagen sind auf Gründächern möglich.

„Der Dachdecker-Innungsbetrieb ist der kompetente Ansprechpartner für die Planung eines Gründachs. Er berät den Bauherren über die Form, die späteren Nutzungsmöglichkeiten und die Art der Bepflanzung, denn all diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle in der statischen Konstruktion und im Schichtaufbau eines Dachs“, erläutert Claudia Büttner, Pressesprecherin des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH). „Der Bauherr ist auch gut beraten, sich über die erforderlichen Pflegemaßnahmen eines Gründachs genauestens zu informieren, damit er lange Freude am begrünten Dach hat“, so Büttner weiter. Je nach Größe des geplanten Daches muss eine Auswahl an geeigneter Bepflanzung getroffen werden.
Darüber kommt ein Schutzvlies, welcher wiederum die Wurzelfolie schützt und zudem wertvolle Nährstoffe und Wasser speichert. Eine Drainage sorgt dann dafür, dass Niederschlagswasser gespeichert wird, damit bei der Dachbegrünung die Entwässerung funktioniert und überschüssiges Wasser sicher abgeführt wird. Außerdem wird die Belüftung des Wurzelraumes sichergestellt. Dann folgt das Filtervlies der Dachbegrünung. Es schützt die Tragschicht vor Auswaschung kleiner Partikel. Zum Schluss wird ein spezielles Mineralsubstrat für Dachbegrünungen aufgeschüttet, welches den Pflanzen Halt gibt und sie mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Um zu verhindern, dass Steine, Schmutz und Pflanzenreste vom Dach fallen und die Dachrinne verstopfen, ist es sinnvoll, eine Kiesfangleiste anzubringen.
Dachkonstruktion
Die Dachkonstruktion muss den bauaufsichtlichen Anforderungen entsprechen und die statischen und dynamischen Lasten während der Herstellung und des Betriebs schadlos aufnehmen und ableiten können. Folgende Konstruktionsarten werden bei genutzten Dächern und Decken unterschieden:
- Einschalige Bauweise als gedämmtes oder ungedämmtes Warmdach, mit oder ohne zusätzliche Abdichtung.
- Als Sonderformen der einschaligen Bauweise (Warmdächer) gelten das WU-Betondach sowie das Umkehrdach.
- Zweischalige Bauweise als Kaltdach, mit oder ohne Wärmedämmung auf der unteren Schale und einer Abdichtung auf der oberen Schale.
Einschaliges, nicht belüftetes Dach ohne Wärmedämmung – Warmdach
Dachkonstruktionen ohne Wärmedämmung kommen z.B. bei Garagen, Carports und Balkonen zum Einsatz, also oberhalb nicht geheizter Räume. Normalerweise sind sie für alle Begrünungsarten und Vegetationsformen geeignet. Wenn an der Deckenunterseite Minus-Temperaturen auftreten, kann dies unter Umständen die Vegetation schädigen.
Einschaliges, nicht belüftetes Dach mit Wärmedämmung – Warmdach
Dachkonstruktionen mit Wärmedämmung kommen bei Bauwerken in der Regel oberhalb geheizter Räume zum Einsatz. Beim konventionellen Warmdach ist eine witterungsbe-ständige Dachabdichtung über der Wärmedämmschicht angeordnet. Normalerweise ist auch diese Variante für alle Begrünungsarten und Vegetationsformen geeignet.
Einschaliges, nicht belüftetes Dach mit Wärmedämmung – Umkehrdach
Bei einem Umkehrdach wird die Dämmung über die Dachabdichtung verlegt. Bei der Begrünung von einem Umkehrdach sind insbesondere die Dampfdiffusionsvorgänge zu beachten. Über der Dämmung muss eine Sickerschicht und eine Filterschicht eingebaut werden, um die Dämmung vor Staunässe zu schützen. In der Regel sind auch hier alle Begrünungsarten und Vegetationsformen möglich.
Zweischaliges Dach mit Wärmedämmung, belüftet – Kaltdach
Die Tragfähigkeit der oberen Schale ist meistens gering und muss auf das Gewicht der Begrünung ausgelegt sein. Die Belüftungsebene zwischen Holzschalung und Dichtungsbahn sorgt für den Abzug der warmen und feuchten Luft. Die bauphysikalischen Vorgänge können durch den Kühleffekt einer Dachbegrünung beeinfusst werden. In der Regel sind alle Begrünungsarten und Vegetationsformen möglich.
Betriebssuche für Dachdecker- und GaLaBau-Betrieben für Ihr Projekt
Dachdecker für Ihr
Gründach-Projekt gesucht?

Auf der Suche nach einem Dachdeckerbetrieb für Ihr Gründach-Projekt?
Experte für Garten- und Landschaftsbau gesucht?

Auf der Suche nach einem Fachexperten für Dachbegrünung?
Informationen für Planer und Architekten zum Thema Gründach
1. Einleitung
Gründächer sind mehr als nur eine ästhetische Bereicherung für Gebäude; sie bieten eine Vielzahl von ökologischen, ökonomischen und sozialen Vorteilen. Bei der Planung eines Gründachs sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, insbesondere Optik, Nachhaltigkeit, Statik sowie die Integration von Solartechnologien und Maßnahmen zum Klimaschutz.
2. Planung
a. Optik
- Gestaltungsmöglichkeiten:Gründächer bieten eine flexible Gestaltung, die von extensiven (gering pflegeintensiven) bis zu intensiven (aufwendigen) Systemen reicht. Die Auswahl der Vegetation kann an das architektonische Konzept angepasst werden.
- Farb- und Strukturvielfalt:Unterschiedliche Pflanzenarten erzeugen saisonale Farbwechsel und Texturen, die das Erscheinungsbild des Gebäudes dynamisch verändern.
- Zugänglichkeit: Bei intensiven Gründächern kann auch eine Nutzung als Dachgarten oder -terrasse in die Planung einfließen, was die Aufenthaltsqualität erhöht.
b. Nachhaltigkeit
- Biodiversität: Gründächer fördern die Artenvielfalt, indem sie Lebensräume für Pflanzen und Tiere schaffen. Die Auswahl von einheimischen Pflanzen unterstützt die lokale Flora und Fauna.
- Wassermanagement: Gründächer können Regenwasser speichern, die Versickerung fördern und so die Kanalisation entlasten. Sie tragen zur Reduzierung von Starkregenereignissen bei.
- Luftqualität: Vegetation filtert Schadstoffe aus der Luft und verbessert somit die Luftqualität in urbanen Räumen.
3. Statik
- Lastenberechnung: Bei der Planung eines Gründachs muss die zusätzliche Last durch Substrat, Vegetation und gegebenenfalls Wasser berücksichtigt werden. Statiker sollten in die Planung frühzeitig einbezogen werden.
- Materialwahl: Die Auswahl von leichten Materialien für die Dränage und das Substrat kann helfen, das Gesamtgewicht zu reduzieren.
- Dachneigung: Die Neigung des Daches beeinflusst die Auswahl der Pflanzen und die Stabilität des Systems. Flachere Dächer benötigen besondere Maßnahmen zur Verhinderung von Erosion.
4. Integration von Solartechnologien
- Photovoltaik-Anlagen: Die Kombination von Gründächern mit Photovoltaik kann die Energieeffizienz eines Gebäudes erhöhen. Das Gründach bietet einen natürlichen Kühlungseffekt, der die Effizienz der Solarmodule steigert.
- Planung der Ausrichtung: Bei der Planung einer Photovoltaikanlage auf einem Gründach sollte die Ausrichtung und Neigung optimal gewählt werden, um maximale Sonneneinstrahlung zu gewährleisten.
- Kombinierte Systeme: Es sind Systeme erhältlich, die eine Kombination aus Vegetation und Solarmodulen ermöglichen, wodurch die Vorteile beider Technologien genutzt werden.
5. Klimaschutz
- CO2-Bindung: Gründächer tragen zur CO2-Reduktion bei, indem sie Kohlenstoff in der Vegetation binden.
- Stadtklima: Gründächer helfen, die städtische Wärmeinsel-Effekte zu reduzieren und tragen zur Kühlung urbaner Räume bei.
- Energieeinsparung: Durch die Isolationseigenschaften von Gründächern kann der Energieverbrauch für Heizung und Kühlung gesenkt werden, was zu einem geringeren ökologischen Fußabdruck führt.
6. Fazit
Gründächer bieten vielfältige Vorteile für die Architektur und Stadtplanung. Bei der Planung sollten Aspekte wie Optik, Nachhaltigkeit, Statik und die Integration von Solartechnologien berücksichtigt werden, um ein effektives und ästhetisch ansprechendes Gründach zu gestalten. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Architekten, Statikern und Landschaftsplanern ist entscheidend, um die Potenziale eines Gründachs voll auszuschöpfen und gleichzeitig den Anforderungen des Klimaschutzes gerecht zu werden.
1. Tragfähigkeit der Dachkonstruktion
a. Statik und Lastenberechnung
Eines der wichtigsten Kriterien für die Eignung eines Daches als Gründach ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion. Gründächer bringen zusätzliche Lasten mit sich, die durch das Substrat, die Pflanzen und das Wasser entstehen.
- Lasten: Eine grobe Schätzung zeigt, dass ein extensives Gründach (5-15 cm Substrat) etwa 80-150 kg/m² wiegt, während ein intensives Gründach (15-30 cm Substrat) bis zu 300 kg/m² oder mehr wiegen kann.
- Statikprüfung: Lassen Sie eine statische Berechnung durch einen Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass die bestehende Dachkonstruktion die zusätzlichen Lasten tragen kann. Möglicherweise sind Verstärkungen erforderlich.
2. Dachneigung
Die Neigung des Daches spielt eine entscheidende Rolle bei der Eignung für ein Gründach.
- Flachdach: Idealerweise sollte das Dach eine minimale Neigung von 1-2 % aufweisen, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten. Flachdächer sind am besten für extensive Gründächer geeignet.
- Steildach: Bei Ziegeldächern mit einer Neigung von 20 % oder mehr sollten spezielle Lösungen zur Sicherstellung der Wasserdurchlässigkeit und der Stabilität des Substrats in Betracht gezogen werden. Hier können beispielsweise spezielle Halterungen oder Trägersysteme erforderlich sein.
3. Dachabdichtung
Eine hochwertige Wasserdichtheit ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser in die darunterliegenden Schichten zu verhindern.
- Materialien: Die Dachabdichtung sollte aus Materialien bestehen, die sowohl wasserdicht als auch wurzelfest sind. Übliche Materialien sind Bitumenbahnen, EPDM-Folien oder Flüssigkunststoffe.
- Überprüfung: Überprüfen Sie den Zustand der bestehenden Dachabdichtung. Bei Schäden oder Verschleiß sollte diese vor der Installation eines Gründachs erneuert oder repariert werden.
4. Entwässerungssystem
Ein effektives Entwässerungssystem ist entscheidend, um Staunässe und mögliche Wasserschäden zu vermeiden.
- Dränageschicht: Diese sorgt dafür, dass überschüssiges Wasser abfließen kann und verhindert, dass das Substrat zu nass wird. Dränageplatten oder -matten sind gängige Lösungen.
- Abläufe: Stellen Sie sicher, dass ausreichend Abläufe vorhanden sind, um das Wasser vom Dach schnell abzuführen. Diese sollten regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden.
5. Zugänglichkeit und Wartung
Ein Gründach erfordert regelmäßige Pflege, um die Gesundheit der Pflanzen zu gewährleisten und das System funktionsfähig zu halten.
- Zugänglichkeit: Planen Sie Zugänge für Wartungsarbeiten ein. Dies kann durch integrierte Wege oder Treppen erfolgen, die die Erreichbarkeit der Pflanzen und der Entwässerungssysteme sicherstellen.
- Pflegekonzept: Entwickeln Sie ein Pflegekonzept, das regelmäßige Inspektionen, Bewässerung, Düngung und gegebenenfalls das Entfernen von Unkraut umfasst.
6. Genehmigungen und rechtliche Aspekte
Bevor Sie mit der Umsetzung beginnen, müssen Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen klären.
- Baugenehmigung: Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und Genehmigungsanforderungen für die Installation eines Gründachs. In vielen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich.
- Sicherheitsvorschriften: Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, insbesondere in Bezug auf Statik und Brandschutz.
Fazit
Nicht jedes Dach ist automatisch für ein Gründach geeignet. Eine gründliche Prüfung der technischen Voraussetzungen ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Ihr Dach die zusätzlichen Anforderungen erfüllt. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten und führen Sie die notwendigen Berechnungen und Prüfungen durch, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. Ein gut geplantes und ausgeführtes Gründach kann nicht nur die Lebensqualität erhöhen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Umwelt leisten.
1. Planung und Gestaltung
a. Statik und Tragfähigkeit
- Lastenberechnung: Berücksichtigen Sie die zusätzliche Last durch Substrat, Vegetation und Wasser. Die Tragfähigkeit des Daches muss entsprechend berechnet und gegebenenfalls angepasst werden.
- Materialwahl: Verwenden Sie leichte Baumaterialien für die Dränage und das Substrat, um die Belastung zu minimieren.
b. Neigung des Daches
- Minimale Neigung: Flachdächer sollten eine minimale Neigung von etwa 1-2 % aufweisen, um einen effektiven Wasserabfluss zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
- Entwässerung: Planen Sie geeignete Entwässerungssysteme, um das Wasser effizient abzuleiten. Dies kann durch Dachabläufe oder Rinnen erfolgen.
c. Vegetation
- Pflanzenauswahl: Wählen Sie Pflanzen, die an die Bedingungen des Standorts angepasst sind. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Lichtverhältnisse, Wind und lokale Klimabedingungen.
- Biodiversität: Fördern Sie eine vielfältige Vegetation, um das ökologische Gleichgewicht zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit des Systems zu erhöhen.
2. Technische Details
a. Schichtenaufbau eines Gründachs
- Dachabdichtung: Die Abdichtung muss absolut wasserdicht sein und gegen Wurzelwachstum geschützt werden. Verwenden Sie geeignete Wurzelschutzfolien.
- Dränageschicht: Planen Sie eine effektive Dränageschicht, die überschüssiges Wasser ableitet und die Pflanzen vor Staunässe schützt.
- Substratschicht: Die Dicke des Substrats sollte je nach Pflanzenart und Nutzung des Daches variieren. Für extensive Gründächer sind 5-15 cm ausreichend, für intensive Gründächer 15-30 cm.
b. Wartungszugänglichkeit
- Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass das Dach für Wartungsarbeiten gut erreichbar ist. Planen Sie entsprechende Zugänge und Wege ein.
- Pflegekonzept: Entwickeln Sie ein Pflegekonzept für die Vegetation, um die Gesundheit der Pflanzen und die Funktionalität des Daches langfristig sicherzustellen.
3. Ökologische und ökonomische Aspekte
a. Energieeffizienz
- Dämmung: Gründächer bieten zusätzliche Dämmung, die den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung reduziert. Berücksichtigen Sie dies in der energetischen Planung des Gebäudes.
- Klimaanpassung: Gründächer tragen zur Minderung des städtischen Wärmeinseleffekts bei und verbessern das Mikroklima.
b. Fördermittel und Anreize
- Finanzielle Unterstützung:Informieren Sie sich über lokale Förderprogramme für Gründächer, die finanzielle Anreize bieten können.
- Langfristige Einsparungen:Berücksichtigen Sie die langfristigen Einsparungen bei Energie- und Wasserverbrauch sowie die Erhöhung des Immobilienwerts durch ein Gründach.
4. Rechtliche Aspekte
a. Genehmigungen
- Baugenehmigung: Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und Genehmigungsanforderungen für Gründächer.
- Sicherheitsvorschriften: Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, insbesondere in Bezug auf die Statik und den Brandschutz.
b. Wartungsverpflichtungen
- Wartungsverträge: Klären Sie mit dem Bauherrn die Notwendigkeit von Wartungsverträgen zur Pflege des Gründachs.
Fazit
Ein Flachdach als Gründach bietet zahlreiche Vorteile, erfordert jedoch sorgfältige Planung und Umsetzung. Durch die Berücksichtigung der oben genannten Aspekte können Architekten und Planer sicherstellen, dass das Gründach sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist und gleichzeitig zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz des Gebäudes beiträgt. Bei weiteren Fragen oder zur Unterstützung in der Planungsphase stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
1. Dachkonstruktion und Tragfähigkeit
- Statik: Stellen Sie sicher, dass die Dachkonstruktion die zusätzliche Last eines Gründachs tragen kann. Dies umfasst das Gewicht des Substrats, der Pflanzen und eventueller Wassermengen.
- Materialwahl: Verwenden Sie leichte Materialien für die Dränage- und Substratschichten, um die Belastung des Daches zu minimieren.
2. Neigung und Entwässerung
- Dachneigung: Ziegeldächer haben in der Regel eine Neigung von 20 % bis 45 %. Berücksichtigen Sie, dass die Neigung die Auswahl der Pflanzen und das Wassermanagement beeinflusst.
- Entwässerungssysteme: Planen Sie geeignete Entwässerungslösungen, um sicherzustellen, dass überschüssiges Wasser abfließen kann. Dies kann durch Dachrinnen, Abläufe oder spezielle Dränagesysteme erreicht werden.
3. Schichtenaufbau eines Gründachs
- Dachabdichtung: Eine hochwertige, wasserdichte Abdichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser in die darunter liegenden Schichten zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung auch gegen Wurzelwachstum geschützt ist.
- Dränageschicht: Diese Schicht sorgt dafür, dass überschüssiges Wasser abfließt und das Substrat nicht zu nass wird. Verwenden Sie dafür geeignete Dränageplatten oder -matten.
- Wurzelschutzfolie: Diese Schicht schützt die Abdichtung vor Wurzeln und verhindert das Eindringen von Substrat in die Dränageschicht.
4. Vegetation und Pflanzenauswahl
- Pflanzenarten: Wählen Sie Pflanzen, die an die Bedingungen des Standorts angepasst sind und die spezifischen Anforderungen des Ziegeldachs erfüllen. Berücksichtigen Sie Lichtverhältnisse, Wind und regionale Klimabedingungen.
- Biodiversität: Fördern Sie eine vielfältige Vegetation, um das ökologische Gleichgewicht zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit des Systems zu erhöhen.
5. Wartung und Pflege
- Zugänglichkeit: Planen Sie Zugänge für Wartungsarbeiten auf dem Dach ein. Eine gute Erreichbarkeit ist entscheidend, um die Vegetation zu pflegen und das System in gutem Zustand zu halten.
- Pflegekonzept: Entwickeln Sie ein Pflegekonzept, das regelmäßige Inspektionen, Bewässerung und Düngung umfasst, um die Gesundheit der Pflanzen sicherzustellen.
6. Ökologische und ökonomische Aspekte
- Energieeffizienz: Gründächer bieten zusätzliche Dämmung, die den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung reduziert. Berücksichtigen Sie dies in der energetischen Planung des Gebäudes.
- Fördermittel: Informieren Sie sich über lokale Förderprogramme für Gründächer, die finanzielle Anreize bieten können.
- Langfristige Einsparungen:Berücksichtigen Sie die langfristigen Einsparungen bei Energie- und Wasserverbrauch sowie die Erhöhung des Immobilienwerts durch ein Gründach.
7. Rechtliche Aspekte
- Genehmigungen: Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und Genehmigungsanforderungen für Gründächer.
- Sicherheitsvorschriften: Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, insbesondere in Bezug auf die Statik und den Brandschutz.
Fazit
Ein Ziegeldach als Gründach bietet eine attraktive Möglichkeit, die Vorteile beider Systeme zu kombinieren. Durch sorgfältige Planung und Umsetzung können Architekten und Planer sicherstellen, dass das Gründach sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist und gleichzeitig zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz des Gebäudes beiträgt. Bei weiteren Fragen oder zur Unterstützung in der Planungsphase stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
1. Grundlegende Überlegungen
a. Tragfähigkeit der Dachkonstruktion
- Statik: Stellen Sie sicher, dass die Dachkonstruktion die zusätzlichen Lasten durch das Gründach (Substrat, Pflanzen, Wasser) und die Solaranlage (Photovoltaik- oder Solarthermie-Module) tragen kann. Führen Sie eine detaillierte statische Berechnung durch.
- Materialwahl: Verwenden Sie leichte Materialien für die Dränage- und Substratschichten, um das Gewicht zu minimieren.
b. Dachneigung
- Flachdächer: Diese sollten eine minimale Neigung von 1-2 % aufweisen, um eine effektive Entwässerung und die Vermeidung von Staunässe zu gewährleisten.
- Ziegeldächer: Bei Ziegeldächern ist die Neigung in der Regel steiler. Berücksichtigen Sie die Auswirkungen der Neigung auf die Auswahl der Pflanzen und die Installation der Solarmodule.
2. Schichtenaufbau eines Gründachs
a. Dachabdichtung
- Eine hochwertige, wasserdichte Abdichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser in die darunter liegenden Schichten zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung auch gegen Wurzelwachstum geschützt ist.
b. Dränageschicht
- Diese Schicht sorgt dafür, dass überschüssiges Wasser abfließt. Verwenden Sie geeignete Dränageplatten oder -matten, um das Wasser effizient abzuleiten.
c. Wurzelschutzfolie
- Diese Schicht schützt die Dachabdichtung vor Wurzeln und verhindert das Eindringen von Substrat in die Dränageschicht.
d. Substratschicht und Vegetation
- Wählen Sie ein leichtes, gut durchlässiges Substrat, das für die Pflanzen geeignet ist. Die Auswahl der Pflanzen sollte an die Bedingungen des Standorts angepasst werden.
3. Integration von Solartechnologien
a. Photovoltaik (PV)
- Modulplatzierung: Bei Flachdächern können die Solarmodule in einem optimalen Winkel aufgeständert werden, um die maximale Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Bei Ziegeldächern können die Module direkt auf der Dachfläche installiert werden.
- Kombinierte Systeme: Es gibt Systeme, die PV-Module und Gründächer kombinieren, sodass die Vorteile beider Technologien genutzt werden können. Diese Systeme bieten eine Kühllösung für die Module, was deren Effizienz steigert.
b. Solarthermie
- Wärmegewinnung: Solarthermie-Module können zur Warmwasserbereitung verwendet werden. Bei der Planung sollten die spezifischen Anforderungen an die Integration in das Gründach berücksichtigt werden.
4. Wartung und Zugänglichkeit
- Zugänglichkeit: Planen Sie Zugänge für Wartungsarbeiten an beiden Systemen (Gründach und Solaranlage) ein. Eine gute Erreichbarkeit ist entscheidend, um sowohl die Vegetation zu pflegen als auch die Solarmodule zu reinigen und zu warten.
- Pflegekonzept: Entwickeln Sie ein integriertes Pflegekonzept, das regelmäßige Inspektionen, Bewässerung und Düngung für das Gründach sowie Wartung der Solaranlage umfasst.
5. Ökologische und ökonomische Aspekte
a. Energieeinsparungen
- Gründächer bieten zusätzliche Dämmung, die den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung reduziert. Dies sollte in der energetischen Planung des Gebäudes berücksichtigt werden.
- Die Kombination von Gründächern mit Solaranlagen kann die Energieproduktion maximieren und die Betriebskosten senken.
b. Fördermittel und Anreize
- Informieren Sie sich über lokale Förderprogramme für die Installation von Gründächern und Solaranlagen, die finanzielle Anreize bieten können.
- Berücksichtigen Sie die langfristigen Einsparungen bei Energie- und Wasserverbrauch sowie die Erhöhung des Immobilienwerts durch die Installation beider Systeme.
6. Rechtliche Aspekte
a. Genehmigungen
- Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und Genehmigungsanforderungen für die Installation von Gründächern und Solaranlagen.
- Berücksichtigen Sie die Anforderungen an Brandschutz und Sicherheitsvorschriften.
Fazit
Die Kombination von Gründächern mit Solartechnologien auf Flach- und Ziegeldächern bietet eine hervorragende Möglichkeit, ökologische Vorteile mit wirtschaftlichen Einsparungen zu verbinden. Durch sorgfältige Planung und Umsetzung können Architekten und Planer sicherstellen, dass beide Systeme effizient und nachhaltig zusammenarbeiten. Bei weiteren Fragen oder zur Unterstützung in der Planungsphase stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
1. Rechtliche Rahmenbedingungen
a. Denkmalschutzgesetz Sachsen
- In Sachsen unterliegt der Denkmalschutz dem Sächsischen Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG). Dieses Gesetz schützt nicht nur bauliche Anlagen, sondern auch deren Umgebung.
- Vor der Planung eines Gründachs ist es wichtig zu klären, ob das Gebäude als Denkmal eingestuft ist. In diesem Fall sind besondere Genehmigungen erforderlich.
b. Genehmigungsverfahren
- Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung: Vor der Durchführung von Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden muss ein Antrag auf Genehmigung beim zuständigen Denkmalamt gestellt werden.
- Bauvoranfrage: Es kann sinnvoll sein, eine Bauvoranfrage durchzuführen, um vorab zu klären, ob die geplanten Maßnahmen grundsätzlich genehmigungsfähig sind.
2. Technische Anforderungen
a. Tragfähigkeit der Dachkonstruktion
- Stellen Sie sicher, dass die bestehende Dachkonstruktion die zusätzlichen Lasten eines Gründachs tragen kann. Lassen Sie eine statische Berechnung durchführen, um die Tragfähigkeit zu überprüfen.
- Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind spezielle Anforderungen an die Erhaltung der Originalsubstanz zu beachten. Gegebenenfalls sind Verstärkungen oder alternative Lösungen erforderlich.
b. Dachabdichtung und -gestaltung
- Die verwendeten Materialien müssen den Anforderungen des Denkmalschutzes entsprechen und die historische Dachgestaltung nicht beeinträchtigen.
- Achten Sie darauf, dass die Dachabdichtung sowohl wasserdicht als auch wurzelfest ist, ohne die historische Substanz zu schädigen.
3. Gestaltung und Integration
a. Ästhetische Integration
- Berücksichtigen Sie die historische und architektonische Bedeutung des Gebäudes. Das Gründach sollte sich harmonisch in die bestehende Dachlandschaft einfügen und die historische Optik nicht stören.
- Die Auswahl der Pflanzen sollte ebenfalls mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden. Bevorzugen Sie Pflanzen, die zur Umgebung passen und keine negativen Auswirkungen auf die historische Substanz haben.
b. Sichtbarkeit und Zugänglichkeit
- Klären Sie, ob das Gründach von außen sichtbar ist. In vielen Fällen gibt es Vorgaben, die die Sichtbarkeit von neuen Dachaufbauten in denkmalgeschützten Bereichen regeln.
- Planen Sie die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten so, dass die historische Substanz nicht gefährdet wird.
4. Ökologische und ökonomische Aspekte
Förderung und Finanzierung
- Informieren Sie sich über mögliche Fördermittel für die Sanierung und den Umbau von denkmalgeschützten Gebäuden. In einigen Fällen gibt es spezielle Programme, die auch die Installation von Gründächern unterstützen.
- Berücksichtigen Sie die langfristigen Einsparungen durch die erhöhte Energieeffizienz eines Gründachs, auch in denkmalgeschützten Gebäuden.
5. Zusammenarbeit mit Fachleuten
Einbindung von Denkmalpflegern
- Es ist ratsam, frühzeitig Denkmalpfleger oder Fachleute für historische Gebäude in den Planungsprozess einzubeziehen. Diese können wertvolle Hinweise zur Umsetzung geben und helfen, mögliche Konflikte mit dem Denkmalschutz zu vermeiden.
- Eine enge Zusammenarbeit mit dem zuständigen Denkmalamt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
Fazit
Die Planung eines Gründachs in einem denkmalgeschützten Gebäude in Sachsen erfordert besondere Sorgfalt und die Beachtung spezifischer rechtlicher und technischer Vorgaben. Eine frühzeitige Klärung mit dem Denkmalamt und die Einbeziehung von Fachleuten sind unerlässlich, um die Vorteile eines Gründachs sinnvoll und nachhaltig zu nutzen, ohne die historische Substanz des Gebäudes zu gefährden.